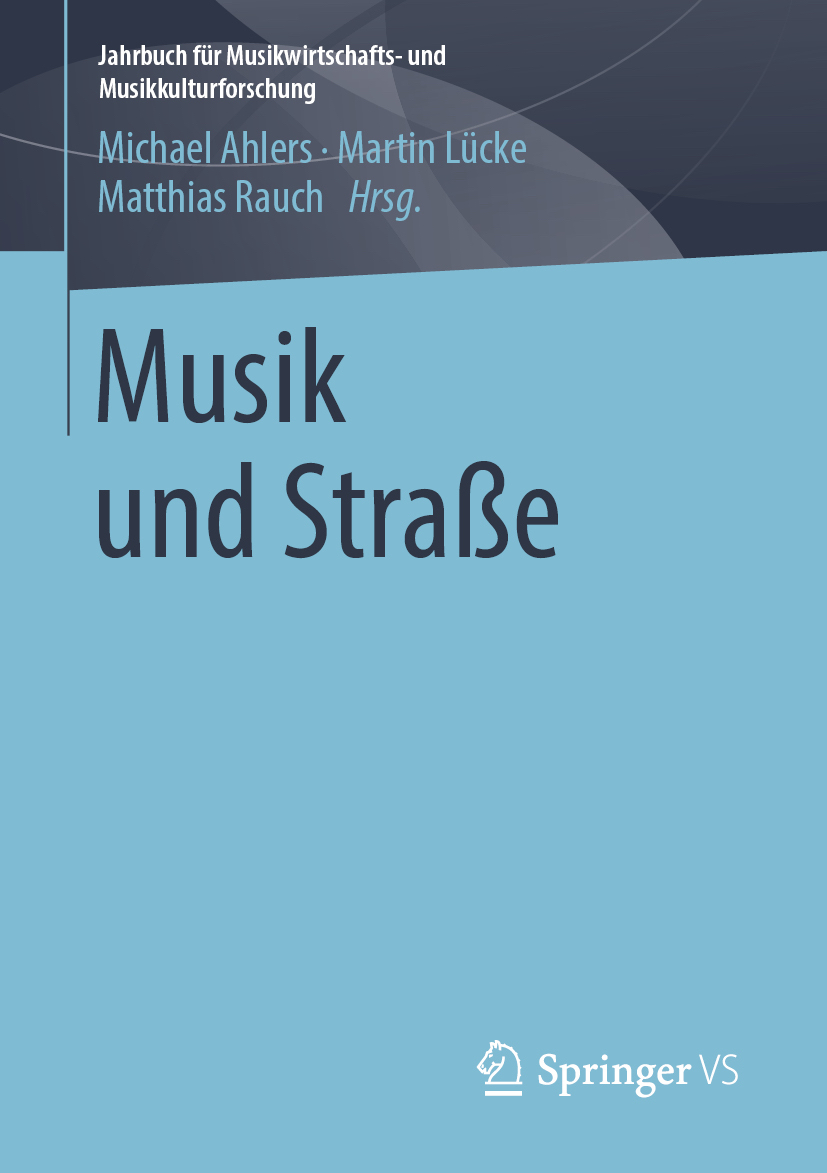English Version Below
Call for Papers: Musik & Krisen
Für das sechste Jahrbuch Musikwirtschafts- und Musikkulturforschung 2021
Herausgeber*innen: Lorenz Grünewald-Schukalla M.A., Prof. Dr. Barbara Hornberger, Dr. Anita Jóri, Dr. Steffen Lepa, Dr. Holger Schwetter und Prof. Dr. Carsten Winter
Musik und Krisen geraten immer wieder in dynamische Zusammenhänge. Das war auch 2020 so, das global ein Krisenjahr war, mit einer Krise, deren Ausmaße, Folgen und Herausforderungen erst absehbar werden. Maßnahmen gegen Covid-19 griffen und greifen global in den Alltag der Menschen ein und drängten z.B. die globale Klimakrise in den Hintergrund, während überall auf der Welt Demokratien und Diktaturen Stresstests mit möglicherweise nachhaltigen Folgen unterzogen wurden und werden.
Covid-19 trifft die Musikwirtschaft- und die Musikkultur hart. Mit dem Live-Sektor kommt ausgerechnet jener Bereich komplett zum Erliegen, der in den letzten Jahren Wachstum schuf und im Tonträgermarkt wegbrechende Einnahmen kompensierte. Für viele Akteur*innen, wie etwa für Solo-Selbständige, aber auch für Veranstalter*innen und Kulturorte brechen Existenzgrundlagen weg. Es wird deutlich: Strukturen und Organisationen, die auch unter Krisenbedingungen von allen für alle Zukunft ermöglichen, sind nur teilweise entwickelt.
Diese Situation bietet der Wissenschaft die Gelegenheit, Musik und Krisen grundlegend zu betrachten. Musik spielt auch und gerade in Krisen vielfältige Rollen: Mit ihr ist es möglich, Kritik zu üben, Stellung zu beziehen, Trends zu verstärken oder Emotionen Ausdruck zu verleihen. Während des Vietnamkriegs wurde mit ihr Widerstand geübt; im 2. Weltkrieg wurden Durchhalteparolen mit Schlagern verstärkt. In jeder Krise steckt immer auch transformatorisches Potential: Krisen beschleunigen Entwicklungen und können dabei z.B. also auch Ungleichheiten verstärken. Nicht zuletzt sind Musikmarkt und Musikkultur ständig von technologischen Transformationskrisen geprägt, als die einige aktuell z.B. die Digitalisierung wahrnehmen, weil hier einige Akteur*innen sich überfordert fühlen und gleichzeitig neue Akteur*innen sichtbar werden.
So stellen sich erneut 2020 Frage nach dem Zusammenhang von Musik und Krise mit Dringlichkeit: Wie ändern sich Zusammenhänge, wie die zwischen Musikkultur und Musikwirtschaft? Welche Rolle spielt (und spielte) Musik in Transformationsprozessen, die durch Krisen ausgelöst werden? Welche Rollen spielt Musik in den vielfältigen aktuellen Krisen: Klimawandel, Covid-19, Europäische Union, Populismus und neue Autokratien, um einige zu nennen? Welchen neuen Schub für die Digitalisierung, für neue Formate und Strategien der Publikumsbindung, aber auch für die Interessenvertretung verschiedenster Akteure treiben die aktuellen Maßnahmen gegen die Pandemie? Wie reagierten Musikkünstler*innen auf die Pandemie-Situation? Verändern Covid-19 und Folgen vielleicht die Produktion und Verteilung oder auch Nutzung von Musik oder gar die Musikkulturpolitik?
Mögliche Themen für das Jahrbuch können sein:
- Neue Herausforderungen für die Interessenvertretung und Musikkulturpolitik
- Musikkulturen als Akteure in Krisen
- Musikmärkte und ökonomische und politische Krisen
- Musiker*innen in der Krise: Fallstudien oder Genre-bezogene Analysen
- Veranstalter*innen in der Krise: Beispiele für Reaktionen, Initiativen, Umgangsweisen, neue (ggf. auch private oder illegale) Formate
- Musikhören in der Krise: Neue individuelle oder kollektive Rezeptionsmuster?
- Covid-19 und neue digitale Streaming-Events: Perspektiven von Kommunikator*innen oder Rezipienten*innen auf ein neues Medienformat
- Krise als Thema in Lyrics und Musikproduktion: Wie werden aktuelle und vergangene Krisen thematisiert?
- Auswirkungen von Corona auf Musikmärkte: Analysen der ökonomischen und kulturellen Folgen
Der Call richtet sich an Wissenschaftler*innen aller Disziplinen, die zu “Musik und Krisen” arbeiten, sowie auch an Künstler*innen oder Akteur*innen der Musikwirtschaft. Erbeten sind Beitragsskizzen (max. 1.500 Worte, Word-Datei) bis zum 30.04.2021 an jahrbuch@musikwirtschaftsforschung.de. Über die Annahme wird bis zum 20.05.2021 entschieden. Die Abgabe der Beiträge wird bis zum 31.07.2021 erwartet. Ausgewählte Beiträge sollen in einem thematischen Konferenzpanel im Spätsommer 2021 in Vortragsform vorgestellt werden. Der Band wird im dritten Quartal 2022 publiziert. Über Hinweise zur Manuskriptgestaltung wird in einer separaten Mail informiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich an jahrbuch@musikwirtschaftsforschung.de.
Call for Papers: Music & Crises
For the sixth yearbook of the German Association for Music Business and Music Culture Research, published in 2022 and edited by Lorenz Grünewald-Schukalla M.A., Prof. Dr. Barbara Hornberger, Dr. Anita Jóri, Dr. Steffen Lepa, Dr. Holger Schwetter and Prof. Dr. Carsten Winter
The interrelationship between music and crises has always been dynamic. This is also true for 2020, which turned out to be a year of global crisis, with resulting consequences and challenges to be seen in the near future. Measures against COVID-19 intervened in people’s everyday lives and pushed the global climate crisis into the background, while democracies and dictatorships all over the world were deeply challenged with long-lasting structural consequences.
COVID-19 has hit the music industry and music culture especially hard. The concert business has come to a complete standstill; the very sector that created growth in recent years and compensated for the loss of income in the recording market. For many protagonists, such as solo self-employed artists, but also for organizers and cultural venues, the basis of their existence has been lost. It is becoming clear that structures and organizations that would guarantee a future for all actors even under crisis conditions, have only been partially developed.
This situation offers scholars the opportunity to take a deeper look at the relationship between music and crises. Music can play a variety of roles in crises: It can be used to criticize something, to take a stand on different themes, to reinforce trends, or to express emotions. During the Vietnam War, music was used for resistance; during World War II, folk songs were employed to popularize perseverance slogans. However, there is always a transformational potential in every crisis: Crises can accelerate sustainable developments and reinforce inequalities. And last but not least, music markets and cultures are also characterized by crises in the wake of technological transformation crises, such as digitization, which can overstrain established actors and make new ones visible.
During the unusual circumstances of 2020, the question of the relationship between music and crisis arises more than ever: How do established relationships change, such as those between music cultures and the music industry? What role does (and did) music play in transformation processes triggered by crises? Which roles does music play in the different current crises (climate change, COVID-19, European Union, populism, and new autocracies, to name a few)? What new drivers for digitization, new formats and audience engagement strategies are created in the current pandemic? How did musicians respond to the pandemic situation? Does COVID-19 change the way music culture is treated politically? And how about its production and distribution and its use?
Possible topics for the yearbook could be:
- New challenges for the standing of music in cultural policy
- Music cultures as actors in crises
- Music markets in financial and political crises
- Musicians in crises: case studies or genre-related analyses of how musicians deal with crises
- Event industry in crises: examples of responses, initiatives, ways of dealing, new event formats (including private or illegal)
- Listening to music in crises: analyses of new individual or collective patterns of reception
- Streaming events: organizers’ or recipients’ perspectives on a new media format
- Crisis as a theme in lyrics and music production: How to make current and past crises a subject of discussion?
- Impact of COVID-19 on music markets: analyses of financial and cultural consequences
The call is addressed to scholars of all disciplines, artists or actors in the music industry who work on the topic of „Music and Crises“. Please submit your abstract (max. 1,500 words, Word file) to jahrbuch@musikwirtschaftsforschung.de until 30.04.2021. The authors of the selected abstracts will be informed by 20.05.2021. Then the submission deadline is 31.07.2021. (The style guide will be provided in a separate email.) Selected contributions are planned to be presented at a conference panel in autumn 2021. The volume will be published in the second half of 2022. If you have any questions, please contact us via jahrbuch@musikwirtschaftsforschung.de